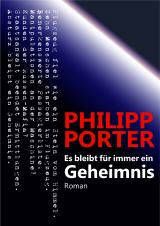Leseprobe
Hier finden Sie einige Leseproben.
Mord im Hainich
Die Scheibenwischer knarrten über die Windschutzscheibe. Jochen Kraidler schaute dem linken Wischerblatt zornig hinterher. Bei nächster Gelegenheit würde er die Blätter austauschen müssen, auch wenn nur einer Ärger machte. Nicht nur das ewige Knarren nervte ihn, auch dass er bei Regen nicht mehr viel sah. Um Haaresbreite hätte er die Einfahrt in den schmalen Waldweg verpasst, der mit einem Pylon gekennzeichnet war.
Langsam ließ Kraidler den Wagen über den schmalen Weg in den Wald hineinrollen. Nach fast fünfhundert Metern erreichte er das Absperrband der Polizei. Suchend schaute er sich durch die verschwommenen Scheiben seines Wagens um, konnte aber niemanden sehen. Er musste wohl zu Fuß noch einige Meter weiter in den Wald hinein. Beim Aussteigen aus dem Wagen schlug ihm kalter Regen entgegen und er zog instinktiv den Kragen seiner Jacke dichter an den Hals heran. Ohne zu wissen, ob er den richtigen Weg nahm, lief er geradeaus. Und schon nach der nächsten Biegung des schmalen Weges sah er seine Kollegen, die sich dicht an einen runden Turm drängten. Sie standen unter dessen sich emporwindender Treppe, um sich vor dem anhaltenden Regen ein wenig zu schützen.
Weit und breit entdeckte er kein Zelt zum Schutz etwaiger Spuren. Vermutlich lag der Tatort noch weiter im Wald verborgen. Kraidler schlüpfte unter einem weiteren Absperrband hindurch und lief mit schnellen, kurzen Schritten zu dem Turm.
„Tagchen“, rief er schon von Weitem und beeilte sich unter die schützende Treppe zu kommen, da der Regen plötzlich an Heftigkeit zunahm. Ein kollegiales Nicken aller Personen war die Antwort und jeder der Kollegen schien den gleichen Gedanken im Kopf zu haben: „Mal schauen, wie sich der Herr vom LKA aus Erfurt macht!“
Die ihm per Mail vorgestellte und in diesem Fall zugeteilte Kollegin Simone Buchner-Puck winkte ihm zu und er bog kurz vor Erreichen der Gruppe links ab, um mit einigen Sprüngen über etwas größere Pfützen zu ihr zu gelangen. Die Mail hatte einen Bildanhang von ihr gehabt, den sich sein Dienstgruppenleiter hätte sparen können. Da Frau Buchner-Puck eine junge, schlanke Person mit feuerrotem Bubikopf war, die noch dazu in einer schwarzen Glattlederhose mit ebenso schwarzer Lederjacke steckte, konnte man sie kaum übersehen.
„Nicht gerade schön heute“, sagte Buchner-Puck und hielt Kraidler ein Handtuch entgegen.
„Danke“, sagte Kraidler und trocknete sich das Gesicht damit ab. „Ich sehe den Tatort nicht. Kein Zelt. Liegt er weiter hinten im Wald? Bei dem Wetter werden wir es schwer haben mit der Spurensicherung. Können Sie mir sagen, weshalb genau ich hier bin? Wer hat mich angefordert? Steht schon fest, wer der Tote ist?“
Simone Buchner-Puck bedachte ihn mit einem fragenden Blick.
„Es gibt keine verwertbaren Spuren am Opfer. Finger- und Schuhabdrücke enorm viele. Die werden aber wohl nichts bringen, da dies hier ein Ausflugsziel ist. Sie werden trotzdem gesichert. Todeszeitpunkt gestern so gegen 22:00 Uhr. Fundort ist Ablageort, meint Hermann und daher …“
„Hermann?“, unterbrach Kraidler seine Kollegin.
„Ja, Klaus-Joachim Hermann, unser Rechtsmediziner. Er fasst immer gerne alle Daten und Fakten an einem Tatort zusammen, auch wenn dies eigentlich die Aufgabe der Tatortermittler ist. Und bevor Sie weiterfragen: Genauer Todeszeitpunkt erst nach der Autopsie.“
Ein breites Grinsen zierte ihr Gesicht und Kraidler wusste, worauf seine Kollegin hinauswollte. Eine gerne gestellte Frage, die aber immer ohne eine genaue Auskunft blieb.
„Und das mit der Ablage ist sicher?“
Buchner-Puck nickte.
„Was ich Sie fragen wollte, sind Sie mit dem Präsidenten des LKA verwandt?“
Buchner-Puck schüttelte den Kopf. „Puck heißt mein Ex. Habe den Namen bei der Heirat angehängt. War damals schon ein Thema in Mühlhausen und in der Polizeiinspektion. Mein Ex ist aber ein Neffe von Werner Puck. Habe mit beiden nichts mehr zu tun. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Aber es wäre schön, wenn Sie nur Buchner zu mir sagen würden. Das Puck können Sie sich schenken.“ Das breite, aufgesetzte Grinsen in Buchners Gesicht sagte Kraidler, dass er eine weitere Frage in diese Richtung tunlichst unterlassen sollte.
„Okay. Sorgen mache ich mir nicht. War nur zur Orientierung. Man muss wissen, mit wem man es zu tun hat.“
Buchner nickte. „Ja, hab mir da auch mal ein paar Infos von Ihnen besorgt. Mein Paps war bei der Volkspolizei, Pass- und Meldewesen, und der hat mir das mit in die Wiege gelegt.“
„DDR-Kind?“
„Ja, bin stolz drauf!“
„Und?“
„Nichts. Alles im Grünen. Sind wohl in Ordnung, auch als zugezogener LKAler aus Hessen. Das mit der Abteilung Staatsschutz irritiert aber.“
„Na, dann bin ich ja beruhigt, dass meine Kollegen nicht geplaudert haben.“ Kraidler grinste.
Der Regen hörte auf und einzelne Sonnenstrahlen durchbrachen die Wolken. Das Glitzern der Wassertropfen an den Blättern der Bäume und Sträucher verzauberte die Umgebung in ein beschauliches Stückchen Erde, wären da nicht das flatternde Absperrband und die Polizeifahrzeuge gewesen.
Kraidler schaute in den Himmel. „Scheint sich zu bessern. Na, dann wollen wir mal.“ Er war schon in Richtung Wald unterwegs, als Buchner ihn zurückpfiff. Irritiert drehte er sich zu seiner Kollegin um, die nach oben deutete. Kraidler sah in die Richtung, in die seine Kollegin wies, und landete bei einer runden Aussichtsplattform weit oberhalb der Baumkronen.
„Das können Sie vergessen …“, murmelte er vor sich hin und kalter Schweiß legte sich auf seine Stirn. Langsam ging er zurück und Buchner sah ihn erschrocken an.
„Mein Gott, Sie sind ja kalkweiß. Ist Ihnen schlecht?“
Kraidler nickte. „Müssen wir da hoch? Ich habe extreme Höhenangst.“
„Aber ihr habt doch auch Hochhäuser in Hessen. Frankfurter Skyline?“
„Im Haus ist das ja auch kein Problem. Aber draußen, wenn ich sehen kann, wie hoch ich bin.“
„Na, wenn es weiter nichts ist. Sie müssen ja nicht runterschauen. Und es gibt eine Treppe im Innern für etwas ängstliche LKA-Beamte. Sie müssen nicht über die Außentreppe hoch. Aber ich denke, Sie verpassen da was. Wir haben nach dem Regen sicherlich eine wunderbare Aussicht bis weit zum Horizont.“
„Wie hoch muss ich?“, fragte Kraidler und langsam kam wieder Farbe in sein Gesicht.
„Knappe vierzig Meter. Der Pfad beginnt bei zehn und führt dann hinauf bis auf fünfundzwanzig Meter. Von dort kann man auch schon über den Wald schauen. Aber von der Plattform aus hat man den besseren Blick.“
Kraidler winkte ab. „Interessiert mich nicht, euer Wald von oben. Wo ist die Tür?“
Buchner deutete nach rechts, an dem Turm vorbei und Kraidler lief los. Er trat unsicher von einem Bein auf das andere und Buchner glaubte ihm, dass er Angst vor der Höhe hatte, denn er bewegte sich vorwärts, als ob er betrunken wäre.
Nach ein paar Minuten, in denen sich Kraidler Stufe für Stufe in dem Turm nach oben gekämpft hatte, erreichte er eine Tür. Der Ausgang führte auf eine runde Aussichtsplattform, die mit einer Brüstung umgeben war. Der Tote saß, zu Kraidlers Erleichterung, direkt rechts neben der Tür. Beide Beine waren ausgestreckt und weit gespreizt, der Oberkörper lehnte rücklings an der Wand. Die weit aufgerissenen Augen und der blutverschmierte Mund des Opfers waren das Erste, was ihm auffiel. Er sah sich kurz um und ging dann in die Hocke, damit die Brüstung ihm die Sicht auf den Horizont verbarg. Er durfte nur nicht nach unten schauen, in die Tiefe, in den Abgrund.
Mit einem Kugelschreiber schob Kraidler vorsichtig die Jacke des Opfers auseinander und schaute sich aufmerksam einen länglichen feinen Einschnitt im Hals des Toten an. Auch hier war, wie am Mund, eine bereits eingetrocknete Blutspur zu erkennen, die sich über die Oberbekleidung verteilt hatte und im Bund der Hose verschwand.
„Wenn er hier erstochen wurde, müsste eine Menge Blut zu sehen sein. Somit gebe ich Ihrem Hermann recht. Das ist eindeutig Ablage. Aber weshalb macht sich ein Mörder die Mühe und schafft sein Opfer hier herauf? Es gibt keinen Aufzug. Das ist Schwerstarbeit. Der wiegt doch mindestens siebzig bis achtzig Kilo. Und was ist mit seinem Mund? Hat der sich auf die Lippen gebissen?“
„Nein. Ihm wurde die Zunge abgeschnitten. Postmortal, sagt Hermann. Aber ganz sicher ist er sich da nicht. Das muss er noch genauer untersuchen. Der Stich ist aber Todesursache. Ausgeblutet.“ Buchner ging ebenfalls in die Hocke.
„Na, dann war es wohl kein Affekt. Wenn jemand impulsiv handelt, nach einem Streit, dann macht man so etwas nicht. Das ist dann geplant oder Symbolik. Ich war vor ein paar Jahren in einer Vorlesung. Äußerst interessantes Thema. Hat man die Zunge bei ihm gefunden?“
„Keine Ahnung. Weshalb?“
„Na, dann wäre es auf jeden Fall Symbolik. Hatte er etwas bei sich? Ein Telefon oder sonst etwas?“
„Ich weiß nicht. Wir hatten die Anweisung den Toten nicht zu durchsuchen und zu warten, bis Sie kommen. Vermutlich ist da ja ein Staatsgeheimnis in seinen Taschen.“
Kraidler stocherte bereits mit seinem Kugelschreiber in allen Jackentaschen des Opfers herum und ignorierte die spitzfindige Bemerkung seiner Kollegin. In den Hosentaschen wurde er fündig. Er zog einen silbernen Schlüsselbund heraus, an dem offensichtlich ein Autoschlüssel hing, und aus der anderen Taschen ein Smartphone, das in einem ledernen braunen Case steckte.
„Können Sie mir mal ein paar Handschuhe besorgen?“, fragte Kraidler über die Schultern hinweg und klappte dabei das Case mit dem Kugelschreiber auf.
„Und holen Sie mal einen Kollegen. Vielleicht steht das Auto von dem Toten auf dem Parkplatz. Mit der Fernbedienung kann man es ja leicht prüfen.“
Wenige Sekunden später bekam Kraidler wortlos ein paar Latexhandschuhe entgegengehalten.
„Irgendwoher kenne ich den …, der kommt mir bekannt vor.“ Buchner ging wieder in die Hocke und schaute sich den Toten aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln an.
Kraidler nahm währenddessen das Telefon in die Hand und hielt es etwas schräg gestellt gegen das Licht. „Na dann wollen wir mal“, murmelte er dabei. „Vielleicht haben wir ja Glück.“
Buchner schaute zu ihm hoch. „Denken Sie wirklich, man kann es so einfach entsperren?“
„Schauen wir mal. Wenn es nicht klappt, geht es zur KTU, die können das auch.“ Mit einer Zickzack-Bewegung führte Kraidler seinen Zeigefinger über das Display hinweg und ein breites Grinsen verzauberte sein Gesicht.
„Haben Sie es?“, fragte Buchner ungläubig und stand auf.
„Ja. Viele Menschen verwenden gerne einen Wischcode. So ein Kreis oder ein Viereck oder Dreieck. Ist halt einfach zu merken und schnell mit einer Hand auszuführen. Ein KTUler hat mir mal gezeigt, wie man erkennen kann, wo der Anfang und wo das Ende von so einer Wischbewegung ist. Ist eigentlich ganz einfach und man könnte es auch gleich sein lassen, das Handy damit zu sperren. Ein vierstelliger Code ist nicht so einfach zu knacken, auch wenn man die Punkte auf dem Display gut erkennen kann. Und mit einer zufälligen Tastenanordnung geht’s schon gar nicht mehr. Mit einem Knock-Code dann schon wieder eher.“
Buchner rollte die Augen und Kraidler verkniff sich weitere Ausführungen. Er tippte und wischte auf dem Display herum und nach wenigen Sekunden verengte sich sein Blick. Eine breite Sorgenfalte schob sich auf seine Stirn. „Von wem wurde ich angefordert?“, fragte er interessiert.
„Direkt von wem?“
„Ja. Muss ja jemand gewesen sein.“
„Keine Ahnung. Nachdem wir die ersten Bilder des Tatorts und des Toten in die Inspektion übertragen hatten, kam kurz darauf eine Mail, dass ein Herr Jochen Kraidler vom LKA, Dezernat 22, kommen würde. Wir sollten alles so belassen, wie wir es vorgefunden haben, und nichts anrühren. Vor allem den Toten selbst nicht. Weshalb fragen Sie?“
„Gibt es häufig Familiennamen in der Region wie Siegesmund, Lauinger, Taubert, Tiefensee oder Gabriel?“
Ammut - Der Clan
Der Anruf kam gegen 22:30 Uhr. Jochen Kraidler hatte gerade die Nachrichten gesehen und sich über die aktuellen Geschehnisse in der Welt informiert, als seine Frau ihm mit ernstem Blick das Telefon entgegenhielt. Er kannte diesen Gesichtsausdruck, der nichts Gutes verhieß.
„Kraidler“, sagte er nur und lauschte in den Hörer hinein. „Ja, ich kenne den Mann.“ Angespannt hörte er weiter zu. Dann nickte er: „Warten Sie, bis ich vor Ort bin.“
Kraidler schaute seine Frau mit einem entschuldigenden Blick an, zog die Schultern nach oben, gab ihr einen Kuss und ging. Er hatte keinen Dienst, er hatte keine direkte Order, aber dennoch konnte er nicht anders. Der junge Marokkaner hatte es schon nicht einfach gehabt, bis er nach Deutschland gekommen war, und nun saß er mit einem Bündel Dollarscheine und einem getöteten syrischen Asylanten in seinem Container und hoffte darauf, dass der Kommissar aus dem LKA ihm helfen würde. Vermutlich, so dachte Kraidler, hätte er nicht anders gehandelt. Er war für den jungen Mann so etwas wie die deutsche Gerechtigkeit, da er ihn bei seinem letzten Fall vor dem Ärgsten bewahrt hatte. Hätte er die Tatwaffe nicht zum LKA nach Kiel geschickt, säße der junge Marokkaner jetzt in einem Gefängnis und würde womöglich auf seine Abschiebung warten.
Kraidler parkte genau an der gleichen Stelle wie ein paar Tage zuvor. Das Gelände des Garten- und Friedhofsamtes war in orangefarbenes Licht getaucht, das die Straßenbeleuchtung über das gesamte Containerdorf und den Innenhof warf. Hier konnte keine Maus die Freifläche überqueren, ohne gesehen zu werden. Im Hintergrund standen mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei und das Blitzen der Blaulichter drückte dem Bild einen surrealen Stempel auf. Von seinen Kollegen, die ihn angefordert hatten, war niemand zu sehen. Vermutlich, so nahm Kraidler an, waren alle in einem der Container, in dem der Leichnam zu finden war. Langsam ging er über den Platz zu den Einsatzfahrzeugen und schaute sich dabei suchend um. Die beiden Kameras, die jeweils an einem hohen Mast in einer Ecke des Areals angebracht waren, hatte er die Tage zuvor nicht bemerkt. Auch wurde hinsichtlich der Ermittlungen nicht darauf hingewiesen. Kraidler ging zu einem der Masten und schaute nach oben. Die Kamera war neu. Dann blickte er zu dem Sockel des Mastes. Und das, was er sah, beantwortete ihm die Frage, weshalb niemand auf die beiden Kameras hingewiesen hatte. Der Erdaushub war frisch und der nicht benötigte Mörtel für den Bodenanker lag noch neben dem Mast. Die beiden Kameras wurden erst nach seinem letzten Einsatz montiert.
In dem Wohncontainer war die Situation angespannt, das konnte Kraidler regelrecht spüren, als er eintrat. Die anwesenden Kollegen standen an den Wänden verteilt und starrten stumm geradeaus. Zwei der Beamten waren dicht bei dem Marokkaner, eine Hand lag griffbereit auf der Dienstwaffe. Es wirkte so, als warteten sie nur darauf, dass der Festgenommene aus einem der Fenster springen und davonstürmen würde. Auf dem Tisch in der Mitte des Raumes lag ein Bündel Dollarscheine. Die orangefarbene Banderole sagte ihm auf den ersten Blick, dass es zehntausend US-Dollar sein mussten. Ein Mordopfer war nicht zu sehen.
„Wo ist der Tote?“, fragte Kraidler in den Raum hinein und ging zum Tisch. Er nahm das Bündel Scheine von der Längsseite auf. „SpuSi schon fertig?“
Ein Beamter trat heran und gab ihm ein Paar Handschuhe. „Sind noch bei einem anderen Fall. Kann etwas dauern. Nehmen Sie so lange die hier.“
Kraidler zog sich die Latexhandschuhe über und ließ danach die einzelnen Scheine des Bündels an seinem Daumen vorbeigleiten, damit er die Anzahl abschätzen konnte. Es waren zehntausend US-Dollar, das stand für ihn fest. Und auf den ersten Blick waren die Dollars echt; keine Blüten. Aber eine genaue Untersuchung würde routinemäßig nicht ausbleiben.
Kraidler wandte sich dem Marokkaner zu und hielt ihm die Dollars entgegen. Dieser hob nur die Schultern und verzog die Mundwinkel zu einem erzwungenen Lächeln.
„Macht ihm die Handschellen ab“, sagte Kraidler zu den beiden Beamten, die sich noch immer an ihrer Dienstwaffe festhielten. „Ich kenne ihn. Er wird nicht flüchten.“
„Ist gegen die Vorschriften“, gab einer der Beamten zurück und nun zog Kraidler die Mundwinkel nach oben.
„Wo ist die Leiche?“
Ein Kollege, der an der Wand stand, deutete auf den Flur hinaus. „Nebenan. Gleich der nächste Container.“ Kraidler warf beim Gehen dem Marokkaner noch einen Blick zu, der so viel sagen sollte, dass er noch ein wenig Geduld haben müsste. Denn eines stand für ihn bereits fest: Sollte der junge Mann der Mörder sein, wäre er sicherlich schon lange verschwunden gewesen. Er hätte ihn nicht mit einem Bündel Dollars auf dem Tisch und einem Leichnam einen Raum weiter holen lassen.
Der Tote lag auf dem Rücken und sein Hemd war mit Blut durchtränkt. Unter ihm, auf dem Linoleumboden, stand eine große Pfütze klebrigen Blutes und Kraidler benötigte keinen Gerichtsmediziner, um zu erkennen, dass das Opfer mit einem gezielten Messerstich in die Brust getötet wurde. „Todeszeitpunkt vor ungefähr zwei Stunden. Aber genau nach der Obduktion …“, murmelte er zu sich selbst und schaute sich dabei in dem Container weiter um. Es sah genauso aus wie in dem Raum nebenan. Gleiches Bett mit Bettwäsche, gleicher Schrank, gleicher Tisch, sogar die Lampen im Zimmer und die Tassen, die in einem kleinen Regal über einer Spüle standen, waren identisch. Der einzige Unterschied zu dem Wohncontainer eine Tür weiter bestand darin, dass hier eine Leiche in ihrem Blut lag.
„Holt mir mal den jungen Mann und nehmt ihm die Handschellen ab. Und dies ist keine Bitte!“, sagte Kraidler über seine Schultern hinweg Richtung Tür und schaute sich den Inhalt des Schrankes dabei an.
Einfach nur Mord
Jochen Kraidler saß an seinem Schreibtisch im LKA Erfurt und schaute sich Tatortbilder an. Er hielt ein Foto, das den Kopf eines Toten großformatig zeigte, in den Händen. Ein massiger, glatt rasierter Schädel mit einem auf den Hinterkopf tätowierten schwarzen Lorbeerkranz, in dem die Zahl achtundachtzig stand, war auf dem Bild zu erkennen. Und direkt in der Mitte des Lorbeerkranzes eine Einbuchtung. Unschwer war zu erkennen, dass der Schlag sehr heftig gewesen sein musste, denn die Schädeldecke war stark verformt und die Kopfhaut ringsum eingerissen.
„Da hatte einer eine ganz schöne Wut im Bauch …”, murmelte Kraidler und zog ein weiteres Foto aus der Mappe heraus. Dieses zeigte die Arme des Toten, in unnatürlicher Stellung verdreht. Auf dem nächsten Bild waren die Beine zu sehen. Hier erkannte er einen zersplitterten Oberschenkelknochen, der spitz aus der Hose des Opfers ragte. Unschwer war zu erkennen, dass der Mann mehrmals an- oder überfahren wurde. Die Tatsache, dass er an der Wand einer Lagerhalle sitzend aufgefunden wurde und man an dieser erhöhte Anhaftungen von seiner Jacke und Hose sichergestellt hatte, legte den begründeten Verdacht nahe, dass er erst stehend und dann sitzend angefahren wurde. Das Opfer musste, so der Bericht der Rechtsmedizin, mehrfach massiv stumpfer Gewalt ausgesetzt gewesen sein – vermutlich durch die Stoßstange eines Fahrzeuges oder ein dazugehöriges Anbauteil. Letztendlich hätte aber ein gezielter Schlag auf den Hinterkopf des Mannes mittels eines stumpfen Gegenstandes den Tod herbeigeführt. Vermutlich, so der Schlusssatz des Berichtes der Rechtsmedizin, wäre das Opfer aber kurze Zeit später auch an seinen schwerwiegenden inneren Verletzungen verstorben.
Kraidler legte die Bilder und den Bericht zur Seite. Er mochte diese Typen mit den Glatzen nicht sonderlich, doch dass man einen Menschen derart zurichtete, konnte er nun auch nicht verstehen und akzeptieren.
In den weiteren Unterlagen war lediglich die Wohnortadresse des Verstorbenen vermerkt. Eine Zugehörigkeit zu einer dem LKA bekannten rechtsextremistischen Gruppierung gab es bisher nicht. Doch dies hatte nichts zu bedeuten.
Kraidler schaute sich die Adresse an und klappte die Mappe zu. Er würde erst einmal in die Wohnung des Toten fahren und sich dort ein wenig umschauen. Dann würde er entscheiden, ob sein Dienststellenleiter ein Team zusammenstellen sollte oder er vorerst weiter alleine ermitteln würde.
Die Kleider und Gegenstände, die das Opfer bei sich gehabt hatte, waren noch in der Rechtsmedizin. Kraidler wollte schon los, um den Wohnungsschlüssel dort zu holen, als er nochmals zur Fallakte griff. Ein kurzer Blick sagte ihm, dass er sich den Weg sparen konnte. Es wurden keine Schlüssel bei dem Opfer gefunden. Lediglich seine Kleidung, seine Schuhe, ein paar handschriftliche Notizen, eine zwei Tage alte Tankquittung, vier Ringe aus Silber, ein billiges Mobiltelefon, sein Personalausweis und ein Klappmesser standen auf der Liste.
Die Fahrt zur Wohnortadresse dauerte nicht lange, da das Opfer direkt in Erfurt gemeldet war. Sie führte nach Norden, über die L2156 in Richtung Ilversgehofen. Kraidler benötigte nach wie vor ein Navigationsgerät, da er sich seit dem Umzug vor fast vier Monaten nach Thüringen immer noch nicht zurechtfand. Die ganzen Stadtteile rund um Erfurt und die kleinen Ortschaften, die stellenweise gerade einmal sechzig oder siebzig Häuser hatten, waren für ihn verwirrend.
Als er die Spittelgartenstraße erreichte und dort einbog, sah er auf der linken Seite einen großen Wohnblock. An der Zieladresse, die die nette Frauenstimme ansagte, der Martin-Niemöller-Straße, war er dann überrascht. Es waren insgesamt drei große Wohnblocks in einer Reihe und einer stand längsseits. Kraidler fasste in die Jackentasche und holte einen Zettel heraus. Nummer 38 stand hinter dem Straßennamen. Die Hausnummer hatte er in das Navi nicht eingegeben und daher hatte die nette Frau mit der immer gleichen netten Stimme ihn lediglich bis zur Einmündung der Martin-Niemöller-Straße navigiert. Langsam fuhr er los, an dem ersten Wohnblock entlang. Die erste Hausnummer war die Sechs. Am Ende des Blockes war die Nummer sechzehn zu lesen. Kraidler bog rechts ab und fuhr in die nächste Straße ein. Er schaute auf die Hausnummer. Die 28 stand in gleicher Ausführung wie die bereits gelesenen über der Eingangstür. Somit waren die Wohnblocks alle mit sechs Hausnummern versehen. Und da er zur Hausnummer 38 musste, konnte es nur der letzte Block sein, die Wohnung musste fast am Ende der Straße liegen.
Kraidler parkte seinen Volvo und schaute an der Frontseite des Wohnblocks entlang. Augenscheinlich keine schlechte Wohngegend. Es sah sauber und aufgeräumt aus. Doch ob er bei den Nachbarn des Toten Erfolg haben würde, sollte er sie befragen, bezweifelte er schon jetzt. Denn in diesen Wohnblocks waren Bekanntschaften unter den Bewohnern eher selten.
Kraidler schaute sich die Namensschilder an. Alle waren sauber beschriftet, keines überklebt, alle in gleicher Schriftart und auf den Millimeter genau platziert. Hier hatte ein penibler Hausmeister alles im Griff. Der Name K. Obermann stand in der zweiten Reihe von oben. Kraidler schaute an dem Haus empor. „Dritter Stock …”, murmelte er und drückte auf einen Klingelknopf rechts neben dem Namen des Opfers. Nach ein paar Sekunden versuchte er es mit der Klingel auf der anderen Seite und kurz darauf summte der elektrische Türöffner.
Im dritten Stockwerk angekommen, schaute er sich um. Keine Tür stand offen und niemand war auf dem Flur. Langsam lief er auf gut Glück los, da das Treppenhaus, aus dem er heraustrat, genau in der Mitte des Gebäudes lag. Als er am Ende des Ganges ankam, wurde hinter ihm eine Tür geöffnet.
„Sie sind falsch …”, flüsterte eine junge Frau mit belegter Stimme. Sie war Mitte zwanzig und schaute Kraidler aus verschlafenen Augen an. Ihre verschmierte Wimperntusche erregte seine Aufmerksamkeit. In den Haaren der Nachtschwärmerin erkannte er bunten Glitter und unter dem Hausmantel einen extrem kurzen roten Minirock aus billigem Kunstleder. Offensichtlich war die junge Frau noch nicht lange zu Hause und schon gar nicht im Bett gewesen.
„Guten Tag. Mein Name ist Kraidler, Jochen Kraidler. LKA Erfurt.”
Die junge Frau nickte und schaute sich seinen Ausweis, den er ihr entgegenhielt, noch nicht einmal an.
Unter Verdacht
Jochen Kraidler starrte auf das Display seines Smartphones und auf die eingegangene Bildnachricht. Er warf Hakim Mohammed Abdu-Jara, der gerade das Gerichtsgebäude durch die große Portaltür verließ, noch einen letzten, verärgerten Blick nach. Dessen letzte Worte waren eine Warnung gewesen, eine Drohung, die direkt an seine Person gerichtet war. Und dies konnte Kraidler ihm nicht einmal verdenken. Denn die Worte des Richters und das Urteil in der verhandelten Angelegenheit waren sehr deutlich gewesen und richteten sich nicht nur an seinen erstgeborenen Sohn, sondern auch an den Abdu-Jara-Clan selbst.
Die Nachricht beinhaltete keinerlei Text. Es war lediglich eine Videosequenz angefügt. Gesendet über einen Nachrichtendienst, den er nicht kannte und auf seinem Smartphone auch noch nie verwendet hatte. In der Voranzeige, die aus einem Bildausschnitt bestand, war ein groß angelegter Polizeieinsatz zu erkennen. Etliche Beamte in Uniform standen vor ebenso vielen Polizeifahrzeugen. Im hinteren Teil des Bildes war ein Haus mit kleinen Fenstern und ein paar Bäumen im Vorgarten zu sehen. Kraidler zögerte. Seine innere Stimme, sein Bauchgefühl sagte ihm, dass diese Nachricht Ärger für ihn bedeutete. Denn das Haus mit den kleinen Fenstern war sein Haus. Er tippte das Bild mit dem Zeigefinger an, um das Video zu starten.
Es war nur eine kurze Sequenz. Höchstens fünfzehn Sekunden lang. Doch das, was er in diesen wenigen Sekunden erkannte, reichte aus, dass er sich auf dem Absatz umdrehte und Bernd Bäumler rücklings zurief: „Ich muss nach Hause. Sofort!“
Ohne auf Antwort zu warten, lief Kraidler mit ausladenden Schritten Richtung Ausgang davon. Bäumler sah ihm verwundert nach und schüttelte ungläubig den Kopf über dieses spontane und äußerst merkwürdige Verhalten seines Kollegen.
„Können Sie mir vielleicht einmal erklären, was mit Ihnen los ist?“, schnaubte Bäumler verärgert und außer Atem über das Wagendach des Volvos hinweg, da er Kraidler erst an der Straße eingeholt hatte. Doch er bekam keine Antwort; Kraidler saß bereits im Wagen und zog seine Tür zu. Eiligst stieg auch Bäumler ein.
Während Kraidler den Startknopf drückte, schaute er zu seinem Kollegen. Dann zog er sein Smartphone aus der Brusttasche und warf es Bäumler in den Schoß.
„Da ist eine Nachricht vom Abdu-Jara-Clan drauf. Von diesem Hakim Mohamed …“, fauchte Kraidler zornig, zog den Wählhebel auf D und schoss gleich darauf aus der Parkbucht. Das protestierende Hupen der gerade anfahrenden Fahrzeuge ignorierte er und zwängte sich in den Straßenverkehr hinein, der vor dem Berliner Landgericht vorbeiführte.
Bäumler schaute sich, während Kraidler jede Lücke im Verkehr nützte, die Videosequenz bereits zum dritten Mal an. „Das ist lediglich eine Hausdurchsuchung und im Hintergrund ist mein Chef zu erkennen“, sagte er verwundert, da er Kraidlers Aufregung nicht verstand.
Kraidler nickte. „Ja, Clemens. Und er hält eine der Stofftaschen in der Hand, die ich in Bad Tölz sicherstellen ließ. Und das Haus, das hinten zu erkennen ist, ist mein Haus!“
Bäumler schüttelte ungläubig den Kopf. „Die Taschen mit dem Falschgeld sind beim BKA, bei den Asservaten. Es ist irgendeine Tasche, die den sichergestellten vielleicht gleicht. Aber was suchen die Kollegen bei Ihnen zu Hause?“
Kraidler warf Bäumler einen zornigen Blick zu, konzentrierte sich aber kurz darauf wieder auf den Straßenverkehr. Bäumlers Frage empfand er wie Hohn.
Nachdem er die Föhrer Brücke passiert und sich auf der Seestraße eingefädelt hatte, trat er das Gaspedal durch, warf Bäumler nochmals einen zornigen Blick zu und folgte der A100 Richtung Messe.
Während der Fahrt sprach Kraidler kein Wort. Seine volle Konzentration galt dem Straßenverkehr und dem Navigationssystem, das ihm die ungefähre Ankunftszeit anzeigte. Erst als der Volvo das Potsdamer Dreieck passierte und Kraidler der A9 Richtung Süden folgte, fragte er in das monotone Fahrgeräusch des Autos hinein: „Denken Sie auch, dass ich eine der Taschen genommen habe?“
Bäumler saß angespannt auf dem Beifahrersitz und schaute ebenso angespannt durch die Frontscheibe. „Sie wissen nicht, ob es eine der Taschen mit den Supernotes ist. Warten Sie es doch erst einmal ab. Denn wenn es so wäre, hätte ich bereits eine Info von den Kollegen erhalten oder Clemens hätte mich direkt kontaktiert. Er weiß ja, dass ich mit Ihnen in Berlin bin.“
Kraidler lachte gequält und betätigte die Lichthupe, um einen blauen BMW zu verscheuchen. „Oder auch nicht. Ich würde Sie weder anrufen, noch würde ich Ihnen eine Nachricht senden. Ich würde nichts davon tun. Ansonsten würden Sie sich mir gegenüber nicht mehr normal verhalten. Sie würden sich unweigerlich verraten.“
„Das ist doch alles völliger Unsinn“, erwiderte Bäumler und suchte Halt in seinem Sitz, da Kraidler einen kurzen Schlenker um einen langsam fahrenden LKW machte. „Sie machen sich nur verrückt. Setzen Sie mich beim LKA ab und fahren danach erst einmal nach Hause zu Ihrer Frau. Die können Sie fragen, was war. Dann können Sie immer noch Verschwörungstheorien ersinnen und diesen nachjagen - sollten wir lebend ankommen“, hängte Bäumler noch an und stemmte beide Beine in den Fußraum, um sich dort abzustützen.
Kraidler lachte bitter. „Verschwörungstheorien? Das Programm, das die Nachricht entgegengenommen hat, verwende ich nicht. Ich habe es weder auf meinem Handy installiert, noch war es Bestandteil der Erstinstallation. Woher kommt also dieses Programm? Wer hat es installiert? Und wer hat mir diese Nachricht gesendet?“
Kurzgeschichten
In vino veritas
Die ersten dicken Regentropfen klatschen auf meinen Kopf. Ich sehe in die dunklen, fast schwarzen Wolken hinein. Es wird wohl nicht viel Zeit vergehen, bis es schütten wird.
Mit beiden Händen fahre ich mir über meine nasse Glatze und ärgere mich, dass ich meinen Hut im Auto gelassen habe. Doch es ist wohl das geringste Problem, das ich nun habe. Ich sehe mich nochmals um. Strenge meine Augen an, um die anbrechende Dunkelheit zu durchdringen. Doch es ist niemand da, bis auf ihn.
Langsam gehe ich in die Arena hinein. Ich bin mir absolut sicher, dass er es ist. Es wäre ansonsten wohl ein dummer Zufall.
Weshalb hatte er angerufen? Am Telefon wollte er es mir nicht sagen. Er tat geheimnisvoll, fast schon dramatisch. Da ich an diesem Wochenende nichts vorhatte, willigte ich ein, zu kommen. War es ein Fehler?
Eigentlich hatte ich keine Lust in diese Angelegenheit, was immer es auch war, mit hineingezogen zu werden. Doch es war wohl schon zu spät. Sie würden ohne große Mühe feststellen, dass ich einer der Letzten gewesen war, der mit ihm telefoniert hatte.
Als ich nur noch wenige Meter entfernt bin, gehe ich in die Knie und sehe mich um. Hunderte von Fußspuren sind zu erkennen. Doch keine Tatwaffe, kein Hinweis, kein Anhaltspunkt. Langsam umrunde ich meinen alten Freund, der mit hölzernem, starrem Blick in die schwarzen Wolken starrt.
"Wer hat dir das nur angetan? Wäre ich schneller gefahren, würdest du dann noch leben?", sage ich leise vor mich hin. Zwei Fragen, auf die es im Moment wohl keine Antworten gibt.
Als ich an seinem Kopf ankomme, sehe ich die tiefe, klaffende Wunde, aus der klebriges Blut sickert.
"Stumpfer Gegenstand, rund, schwer. Eine Tatwaffe wird wohl nicht so leicht zu bestimmen sein", geht es mir durch den Kopf.
Ich schaue mich nochmals um. Nichts! Derjenige, der zuschlug, hat keine verwertbaren Spuren hinterlassen.
Die Tropfen werden dicker, fallen dichter und ich ziehe mein Telefon aus der Handytasche heraus.
...
Das Anagramm
"Was für ein Mistwetter", fluchte Kommissar Hofer leise vor sich hin, während er sich seinen Weg zwischen morschen Brettern, herumliegenden Kübeln und Schafskacke suchte, um zum Tatort zu gelangen. Er hasste Außeneinsätze an solchen Tagen. Weshalb wurden Leichen immer bei schlechtem Wetter gefunden? Er hatte, soweit er sich zurückerinnern konnte, noch nie einen Leichenfund bei Sonnenschein gehabt. Aber über diese Tatsache zu sinnieren war wohl vergebens.
"Und, was haben wir?" Die Frage warf Hofer in die Runde der Männer, die rings um einen Mann standen, der rücklings, wie vom Blitz getroffen, mit weit ausgestreckten Armen und gespreizten Beinen im nassen Gras lag. Sein Gesicht war blutverschmiert und offensichtlich war er tot.
"Ich würde sagen, so gegen Mitternacht. Genauer nach der Obduktion, wie immer."
Hofer schaute zu Dr. Greuslich hinab, der gerade sein spitzes Thermometer aus dem Toten zog, mit dem er die Lebertemperatur gemessen hatte. Mit einem Papiertaschentuch wischte er die dünne Sonde ab und packte sie in seinen Aluminiumkoffer zurück, den er ständig mit sich herumschleppte.
"Todesursache? Tatwaffe? Verwertbare Spuren? Täter?" Hofer sah dabei fragend in die Runde.
"Vermutliche Tatwaffe ist wohl ein stumpfer Gegenstand mit ausgeprägter Struktur. Ein Brett, ein Balken, ein Stein, wir wissen es noch nicht. Wir haben nur das hier", dabei hielt ihm der junge Kollege Schmitt, der seit einem halben Jahr auf der Station arbeitete und Hofer zur Seite gestellt worden war, eine Sprühdose mit roter Farbe und eine Impfpistole eines Veterinärs entgegen.
Hofer nahm beides an sich und schaute sich die Funde, die in Plastiktüten steckten, an. Was ist das?"
...
Mord mit Profil
Die schmalen Lederriemen an den Handgelenken schnitten ihm qualvoll ins Fleisch. Die an den Füßen spürte er kaum. Doch sie fixierten ihn ebenso, Punktgenau. Sie ließen keinen Raum für befreiende Bewegungen. Dann flammten Scheinwerfer auf. Er kannte den markanten Schein, sehr gut sogar. Auch das sonore, tiefe Brummen des Motors, das sich kurz darauf zu einem aggressiven Brüllen emporhob. Dann schoss der Wagen plötzlich vorwärts und überrollte ihn der Länge nach.
Karl Busch stand am Kopf der Leiche und schaute sich die blutrote Reifenspur, die von hier wegführte, mit offen stehendem Mund an. Er hatte schon viel gesehen, so etwas aber noch nicht.
Der Kollege der SpuSi stellte sich neben Busch. "Moin." Busch schaute ihn mit einem Seitenblick wortkarg an. "Hinrichtung. So in der Art vierteilen. Nur mit einigen PS mehr und dass der Rest mehr oder weniger noch an einem Stück ist."
"Also Mord", sagte Busch trocken und der Kollege nickte.
"Ergebnisse aus dem Labor morgen. Wird aber nicht viel sein. Die Holzpflöcke und die Lederriemen kann man überall kaufen und außer dem Profilabdruck, den wir fanden, gibt es keine verwertbaren Spuren."
"Wisst ihr, wer er ist?"
"Nein."
"Macht einen Datenbankabgleich. Vielleicht haben wir ja einen Treffer", sagte Busch und sah sich die noch zu erkennende Gesichtshälfte des Opfers an. "Wie lange ist er schon tot?", fragte er und suchte währenddessen in seinen Taschen nach seinem Handy.
"Seit drei Minuten nach zwei heute Nacht. Er hatte eine Taschenuhr und die blieb genau da stehen."
Busch drehte sich ab. Der Rufton seines Handys drang an sein Ohr. Noch während er sprach, wurde der Leichnam eingesargt und wenig später stand Busch alleine auf dem Feldweg. Außer der Blutspur und den flatternden rot-weißen Absperrbändern gab es keinen Hinweis mehr auf die grauenvolle Tat.
...
Luca und der Weihnachtsbaum
Die Maus
Auf dem kleinen runden Dorfplatz, der genau in der Mitte von Dorndiel lag, standen fünf große Verkaufsstände auf der einen und zwei kleinere Holzbuden auf der anderen Seite.
In den beiden Holzbuden wurden Kinderpunsch, Glühwein, Bratwürste, leckere Waffeln mit Puderzucker und wohlriechende Maronen verkauft. An den großen Verkaufsständen gab es silbrigen und goldglänzenden Christbaumschmuck, allerlei buntes Holzspielzeug und wollene Handschuhe und Mützen zu kaufen.
Der erste Schnee war in diesem Jahr bereits sehr früh gefallen. Die Holzbuden, die Verkaufsstände und der große Weihnachtsbaum, der mitten auf dem Dorfplatz aufgestellt war, waren mit einem dicken weißen Kleid überzogen. Noch eine Woche dauerte es bis Weihnachten und die Bewohner von Dorndiel bummelten auf dem kleinen Weihnachtsmarkt zwischen den Ständen hin und her, unterhielten sich und tranken Glühwein.
Die Kinder spielten Fangen, warfen mit Schneebällen oder bauten Schneemänner, die bereits reihenweise am Rande des kleinen Platzes standen und stumm mit ihren schwarzen Eierkohlenaugen in die Menge schauten.
Plötzlich wurde die weihnachtliche Stimmung auf dem Dorfplatz durch ein lautes Rufen unterbrochen, das über die Köpfe der Besucher hinwegschallte.
„Luca! Luca, wo bist du!?“
„Luca!“, hörte man wieder, dieses Mal noch etwas lauter, und zwischen den Besuchern des Weihnachtsmarktes sah man eine junge Frau mit großen Augen und sie suchte, so wie es schien, zwischen den Beinen der anderen Besucher nach Luca.
„Luca, wo bist du!?“, schimpfte die Frau mittlerweile ärgerlich und schlüpfte dabei zwischen zwei Verkaufsbuden hindurch, vor denen Reisigbesen und hölzerne Heugabeln zum Verkauf angeboten wurden.
„Luca!“
Luca, der an der hinteren Ecke der einen Bude war, drehte den Kopf zur Seite und schaute über seine Schulter hinweg zu seiner Mutter. „Pscht“, flüsterte er dabei und drehte den Kopf wieder zurück. Auf allen Vieren kniete er im Schnee und reckte seinen Kopf so weit nach vorne, dass er von hinten aussah wie eine Schildkröte mit roter Zipfelmütze, die ihren langen, dürren Hals aus einem roten Schildkrötenpanzer streckte.
„Luca, steh sofort auf! Du holst dir noch einen Schnupfen!“, schimpfte seine Mutter und zupfte ihn an seiner Daunenjacke.
„Noch ein klitzekleines Momentchen“, flüsterte Luca leise und streckte dabei einen Arm aus. Nun sah er aus wie eine dicke rote Schildkröte, die auf drei Beinen stand.
„Luca Akkermann. Ich werde es Papa sagen!“, drohte die Mutter und zupfte ihn nochmals an seiner roten Daunenjacke.
Luca hörte gar nicht richtig zu. Sein Papa war zur Arbeit, und bis er in ein paar Tagen wieder nach Hause kommen würde, hätte seine Mutter die Drohung, ihm alles zu erzählen, schon längst wieder vergessen.
„Mama, ich kann noch nicht. Sie ist noch nicht satt“, flüsterte Luca so leise, dass seine Mutter ihn kaum verstehen konnte.
„Wer ist noch nicht satt?“, fragte sie verwundert zurück und trat einen Schritt zur Seite, damit sie an Luca vorbeischauen konnte. „Iiiihhhh ...!“, stieß sie erschrocken hervor, als sie sah, wer da noch nicht satt war. Entsetzt sprang sie auf eine hölzerne Kiste, die neben ihr stand.
Luca konnte sich ein leises Kichern nicht verkneifen. Er wusste, dass seine Mutter vor jedem Tier fürchterliche Angst hatte, das kleiner als Maunzel war. Maunzel war ihre jüngste Katze und sie war ungefähr so groß wie die Hand von seinem Opa. Und die, so fand Luca jedenfalls, war ziemlich groß.
„Die tut dir doch nichts“, flüsterte Luca wieder und hielt einer kleinen rotbraunen Maus mit winzigen schwarzen Knopfaugen ein Stück Lebkuchen direkt unter die Nase.
„Tu sie weg!“, kreischte seine Mutter und fuchtelte dabei mit ihren Händen in der Luft herum, um die Maus zu verscheuchen.
So, als ob die kleine rotbraune Maus es verstanden hätte, schnappte sie nach dem Stück Lebkuchen und sprang mit einem einzigen Satz hinter eine Mauer, an der Spaltholz zum Trocknen aufgeschichtet war. Und schon war sie weg.
Luca lächelte zufrieden. Für die nächsten Tage musste die Maus wohl keinen Hunger mehr leiden. Schon etwas steif gefroren stand er auf und klopfte sich den Schnee von Hose und Jacke. Er sah seine Mutter nicht an, die noch immer auf der Holzkiste stand und ängstlich zum Holzstapel sah. Wenn er ihr nur einen klitzekleinen Moment in die Augen schauen würde, würde sie weiter mit ihm schimpfen. Langsam und ohne nach oben zu schauen, ging er vorsichtig davon. Doch sehr weit kam er nicht.
„Mal schön langsam, junger Mann“, sagte plötzlich seine Mutter. Luca schob seine Jacke ein Stück weit nach oben und zog den Kopf etwas ein. Nun sah er aus wie eine Schildkröte, die ihren Kopf in ihren roten Schildkrötenpanzer eingezogen hatte. Nur die Zipfelmütze und die Augen waren von seinem Kopf noch zu erkennen.
„Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass Mäuse Ungeziefer sind! Wie oft habe ich dir schon verboten, Mäuse zu füttern! Was denkst du, weshalb wir Katzen auf dem Hof halten? Was ist, wenn dich so ein scheußliches Tier beißt? Vielleicht hat die Maus ja auch Tollwut und du musst dann ins Krankenhaus“, schimpfte seine Mutter und einige Besucher des Weihnachtsmarktes blieben neugierig stehen.
Der Junge lugte zwischen roter Winterjacke und Pudelmütze hervor. „Aber Mama, Mäuse haben doch keine Tollwut und sie sind auch kein Ungeziefer. Opa hat gesagt ...“
„Nichts da! Ich möchte diesen Unsinn erst gar nicht hören. Immer wenn ich dir etwas verbiete, kommt: Aber Opa hat gesagt. Denkst du, dein Opa hat immer recht? Opa hat früher auch nicht alles so gesehen. Als ich so alt war wie du, hätte er mir sofort einen Klaps auf den Po gegeben, wenn ich Mäuse gefüttert hätte.“
Luca schob seinen Kopf aus der Winterjacke hervor. „Hast du als Kind keine Tiere gefüttert?“, fragte er trotzig.
Der Flohmarktmörder
Prolog
Claudia Wolf verließ das Klinikgebäude am siebzehnten Juli gegen dreiundzwanzig Uhr. Sie war erleichtert, dass dieser schreckliche Tag endlich vorüber war. Die teilweise schweren Unfälle in der Notaufnahme und den damit verbundenen Stress war sie einfach nicht gewohnt. Auf der Entbindungsstation, in der sie als Schwesternschülerin ihren letzten Dienst absolviert hatte, war es weitaus schöner gewesen. Obwohl die neugeborenen Kinder und auch die zwei Frühchen der Station ihre ständige Aufmerksamkeit benötigten – und teilweise auch lautstark forderten –, hatte sie sich dort nach einem langen Arbeitstag nicht so zerschlagen gefühlt.
Langsam lief Claudia Wolf durch den dunklen Park, der sich hinter dem Klinikgebäude und über den Hügel entlangzog, und genoss die vollkommene Stille um sie herum. Würde jeder Tag in ihrem zukünftigen Leben sich so gestalten, würde sie sich einen anderen Beruf suchen müssen. Doch nicht nur die Arbeit, sondern auch die unfreundlichen Menschen machten ihr zu schaffen. So wie eine Woche zuvor: ein angetrunkener Obdachloser, der sie ständig begrapscht hatte, ein Bauarbeiter, der sie ein geiles Schwesterchen nannte, und vor allem dieser Autoschlosser, der sie in Anwesenheit ihres Chefs so angeschrien hatte, dass sie heulend aus dem Behandlungsraum gelaufen war.
Nach wenigen Schritten hörte sie plötzlich ein leises Rascheln, das aus einer dichten Gruppe von Holunderbüschen kam.
„Hallo“, rief Claudia Wolf zaghaft in die Richtung der Büsche und blieb stehen. „Hallo, ist da jemand?“, rief sie etwas lauter. Doch in ihrer Stimme schwang bereits ein ängstlicher Unterton mit.
Claudia Wolf wollte weitergehen, als erneut das leise Rascheln von Blättern zu hören war. Im schwachen Licht der Laternen, die in weitem Abstand voneinander im Park aufgestellt waren und ihr schwaches Licht wie einen Schleier über den Fußweg legten, sah sie plötzlich einen Mann zwischen den Büschen hervortreten.
Claudia Wolfs Herz schlug urplötzlich um das Doppelte schneller, und um ihren Hals legte sich eine unsichtbare Fessel. „O Gott ...“, stieß sie leise hervor und in ihren Gedanken spielte sich ein Szenario ab, das sie keineswegs erleben wollte. Sie trat einen Schritt zurück und wäre fast über die Grasabgrenzungen gestolpert, die den gesamten Weg säumten. Dann erkannte sie den Mann, der im Halbschatten einer Laterne stand. „Sie?“, sagte Claudia Wolf ungläubig und schaute sich instinktiv nach allen Seiten um. Doch sie war alleine auf dem schmalen Weg. Auch am Parkende oben auf dem Hügel war keine Menschenseele zu sehen.
Nach kurzem Zögern verließ Claudia Wolf mit bedächtigen Schritten den Weg und betrat die Rasenfläche. „Was wollen Sie?“, fragte sie, bekam aber nur ein leises: „Kommen Sie mit“ zu hören.
Claudia Wolf folgte der Aufforderung und schlüpfte zwischen den herunterhängenden Ästen eines Holunderbusches hindurch. „Sagen Sie doch, was wollen Sie von mir?“
Einen Sekundenbruchteil später zerschmetterte eine verchromte Eisenstange Claudia Wolfs Schädeldecke. Ein kurzer Aufschrei wurde durch einen brutalen Schlag gegen ihren Kehlkopf erstickt. Wieder und wieder schoss die verchromte Stange hinab, bis nur noch eine breiige, klebrige Masse von Claudia Wolfs Kopf zu erkennen war.
Kapitel 1
Während Jutta Habermann kleine Brotstücke ins Wasser warf und gelangweilt zusah, wie dicke Karpfen danach schnappten, fragte sie sich, weshalb sie sich für dieses gottverdammte Nest entschieden hatte. Ihr hätte die Welt offen gestanden – nicht gerade die Welt, aber immerhin München. Weshalb nur hatte sie sich für dieses Bad-Kolmbach am Tannenmeer entschieden? Die drei Einbrüche in Wohnhäuser und die paar gestohlenen Autoradios der vergangenen Woche waren nicht gerade die Herausforderung, die sie für ihre berufliche Zukunft gesucht hatte. Lustlos nahm Jutta die letzten Brotwürfel, warf sie einem bunt gefiederten Erpel zu und legte sich rücklings in die Wiese.
Irgendwie, so gestand sie sich ein, war ihr Leben aus den Fugen geraten. Hätte sie sich von Clemens doch nicht trennen sollen? Sie schüttelte den Kopf.
„Nein“, murmelte Jutta leise vor sich hin. „Nein, nein, nein“, wiederholte sie mehrmals und fühlte sich zugleich etwas besser. Clemens lebte in der Vergangenheit, und ihre Problemchen hier in Bad-Kolmbach würde sie über kurz oder lang in den Griff bekommen.
Ironisch lächelnd schaute Jutta über den See und fragte sich zugleich, wer diesem Tümpel wohl den Namen Tannenmeer verliehen hatte. Hier war weder eine Tanne in der Nähe, noch war diese Pfütze ein Meer. Als sie vor einem halben Jahr den Namen Bad-Kolmbach und Tannenmeer zum ersten Mal gehört hatte, dachte sie an eine attraktive Kurstadt und einen See, auf dem weiße Segel- und schlanke Ruderboote kreuzten. Sie liebte Segeln; ihr Segelschein, den sie bereits in früher Jugend gemacht hatte, war bis vor einem halben Jahr sein Geld wert gewesen. Jede freie Minute, die sie sich bei ihrem stets vollen Terminkalender ergattern konnte, verbrachte sie auf ihrem Segelboot und genoss die steife Brise, die über die Ostsee pfiff. Aber dies hier war das Letzte! Eine Pfütze, auf der nicht einmal ein paar Modellboote kreuzten, damit die lieben Entlein und die fetten Fische nicht gestört wurden.
Kinderlachen riss Jutta aus ihren Gedanken. Sie schaute hinüber zu dem Minigolfplatz, der neben dem schmucklosen Kurparkrestaurant angelegt war. Ein Mädchen, ungefähr im gleichen Alter von Vanessa, tollte dort mit seinem Vater und seiner Mutter herum. Im gleichen Augenblick überkam Jutta eine Sehnsucht, die sie bisher selten verspürt hatte. Sie schloss die Augen, legte sich zurück ins Gras und versuchte, sich ‚ihr kleines Mädchen’ in Gedanken vorzustellen. Enttäuscht öffnete Jutta einige Sekunden später die Augen und gestand sich ein, dass sie wohl eine Rabenmutter war.
Die Rolle, in die sie – jedenfalls nach Meinung ihrer Ex-Schwiegermutter – vor sechsunddreißig Jahren hineingeboren worden war, lag ihr einfach nicht. Sie konnte weder einen Mann häuslich betreuen noch ein Kind mütterlich beglucken. Ihr fehlten offensichtlich einige Paare X-Chromosomen, die eine Frau an der richtigen Stelle in sich tragen sollte.
„Mein Kind, du kannst doch nicht ...“, äffte sie ihre Ex-Schwiegermutter nach und dachte an ihren Ex-Mann und dessen blödes Gesicht, als sie ihm vor einem halben Jahr sachlich mitteilte, dass sie sich von ihm und seiner grässlichen Mutter trennen würde. Ob auch sie einmal zu Vanessa in einer ähnlichen Situation das Gleiche sagen würde? Sicherlich nicht; oder doch?
Noch ehe Jutta sich mit diesem Thema auseinandersetzen konnte, wurde sie vom Vibrieren des Handys in ihrer Hosentasche gestört. Hastig schob sie die Hand in die Jeans, zog das Telefon heraus und klappte es auf.
„Habermann“, sagte Jutta in den Winzling hinein und ein Lärmpegel aus Polizeisprechfunk und Straßenlärm drang lautstark an ihr Ohr.
„Wo sind Sie? Kommen Sie umgehend ins Präsidium! Wir haben ein Tötungsdelikt!“
„Beimer?“, fragte Jutta, obwohl sie genau wusste, dass er es war.
„Wer sonst?“, schnaubte Heinz Beimer zurück. „Kennen Sie noch jemanden, der Sie unter dieser Nummer an Ihrem freien Tag anruft?“
„Nein“, murmelte Jutta und gab Beimer recht. Niemand im Präsidium würde auf den Gedanken kommen, einen Kollegen in seiner Freizeit anzurufen, außer er hieß Heinz Beimer und war ihr Partner. Doch da sie an diesem Tag keine weiteren Verpflichtungen hatte – wie auch an ihren anderen freien Tagen –, sagte sie nur: „Ich komme“, und klappte das Handy zu.
Allmählich stieg eine Erregung in ihr auf, die sie schon seit Monaten vermisste. Alleine das Wort ‚Tötungsdelikt’ löste dieses Gefühl in ihr aus, das sie aber zugleich über ihre Einstellung zum Leben anderer Menschen nachdenklich werden ließ. Freute sie sich wirklich, dass ein anderer Mensch tot war, oder war es die Herausforderung, den oder die Täter dingfest zu machen?
„Egal“, sagte Jutta zu sich selbst, schnappte die leere Plastiktüte, in der die Brotwürfel für die Fische gewesen waren, und hetzte zu ihrem silberfarbenen BMW, der in der Nähe geparkt war.
Jutta machte sich nicht erst die Mühe, die Tür zu öffnen. Sie sprang mit einem Satz in den offenen Wagen und drehte den Schlüssel im Zündschloss, noch ehe sie richtig saß. Mit Vollgas und durchdrehenden Reifen steuerte sie den Wagen aus dem Parkplatz hinaus und jagte kurz darauf die kurvenreiche Landstraße zur Kreisstadt hinauf.
Das Geheimnis
Kapitel 1
Andreas Stein nahm den Fuß vom Gaspedal und ließ den BMW ausrollen. Bereits bei der Anfahrt, noch vom Haupttor aus, hatte er sich über die Autos gewundert, die direkt vor Hangar 12a parkten. Und jetzt, da er den beiden weißgrünen Wagen immer näher kam, wurde er nervös.
Mit einem kurzen, hektischen Blick überflog er das Flughafengelände vor ihrem Hangar. Es war nichts Auffälliges zu erkennen, sah er von den zwei Polizeifahrzeugen, einem in die Jahre gekommenen grauen Audi mit Berliner Kennzeichen und einem E-Klasse-Kombi, ebenfalls mit Berliner Nummer, einmal ab.
Steins Blick blieb verbissen an den weißgrünen Polizeiwagen hängen, während er näher und näher an sie heranrollte. In seiner Magengegend breitete sich ein ungutes, ihm aber bekanntes Gefühl aus. Er spürte, wie sein Mund langsam trocken wurde und wie sich kleine, kalte Schweißperlen auf seiner Stirn bildeten.
Er hatte in den letzten Monaten ständig ein ungutes Gefühl gehabt, wenn ihm ein Polizeifahrzeug zu nahe kam, und suchte, wenn irgendwie möglich, sofort das Weite. Doch an diesem eiskalten Februarmorgen, an dem er am liebsten zuhause in seinem Bett geblieben wäre, ging es nicht. Einerseits, weil Gordon Miller – sein neuer Kopilot – neben ihm saß und ebenfalls neugierig das Gelände musterte, und andererseits, da sie in einer Stunde einen Flug nach Salzburg hatten.
Aufgeregt fing Miller, der in Steins Augen durch Ausdruck, Gestik und Konservatismus das königliche Großbritannien in reinster Form verkörperte, an zu plappern: „Was ist da los? Ein Einbruch? Vielleicht hat Wagner ein … wie sagt man hier … ein krummes Ding gedreht? Es könnte auch sein, dass …“
Weiter kam Miller nicht. Stein unterbrach seinen Redefluss abrupt und schrie ihn wüst an: „Sei still! Du machst mich vollkommen verrückt!“
Miller zuckte bei diesem für ihn völlig unerwarteten Wutausbruch seines Kollegen zusammen. Ruckartig fuhr er zu Stein herum und wollte ihm wegen dieser rüden und vollkommen unbegründeten Behandlung – die er keineswegs verdient hatte – etwas entgegenwerfen. Doch er ließ es. Steins kalte, zornige Augen, die ihn bewegungslos anstarrten, hielten ihn davon ab.
*
Der BMW rollte zwischen den geparkten Polizeifahrzeugen aus, und noch ehe Stein den Motor abstellen konnte, öffnete Miller die Beifahrertür und stieg aus dem Wagen. Beleidigt, ohne noch weiter auf Stein zu achten, marschierte er mit hoch erhobenem Kopf in Richtung Hangar 12a davon.
Stein blieb im Wagen sitzen und versuchte diese merkwürdige Situation irgendwie einzuschätzen. Während seine Finger mit den noch immer im Zündschloss steckenden Schlüsseln herumspielten, überlegte er krampfhaft, was in dem Hangar los sein könnte. Sollte er wieder fahren oder sollte er sich der Situation stellen? Wenn er jetzt fahren würde, wäre er sofort verdächtig, auch wenn er mit der Sache – was auch immer hier geschehen war – nichts zu tun hatte. Doch sollte die Polizei wegen ihm und Wagner hier sein, würde er ihnen direkt in die Arme laufen und das wäre mit Sicherheit eine Dummheit. Er hatte keine Lust, für eine Sache, in die er aus reiner Naivität hineingeschlittert war, ins Gefängnis zu gehen.
Während Stein die Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen versuchte, verrann die Zeit. Als sich nach Minuten vor dem Hangar noch immer nichts regte, zog er beherzt den Schlüssel aus dem Zündschloss und stieg aus.
Langsam, noch immer mit dem unguten Gefühl in der Magengegend, das sich verstärkte, je näher er dem Hangar kam, lief er auf das weit geöffnete Tor zu. Er war bei jedem seiner Schritte darauf gefasst, dass aus irgendeiner Ecke Polizisten auf ihn zustürmen würden; doch nichts geschah.
Mit jedem Schritt, der ihn dem Gebäude näher brachte, versuchte er im Innern der düsteren Halle etwas zu erkennen. Doch außer ihren zwei Flugzeugen, die schemenhaft im hinteren Teil des Hangars auszumachen waren, dem kleinen roten Traktor, den sie benutzten, um die Maschinen auf dem Flughafengelände zu bewegen, und einigen halb geöffneten Werkzeugkästen war nichts zu erkennen.
Erst als Stein in den dunklen Hangar hineintrat und das gleißend helle Morgenlicht hinter sich ließ, sah er, was los war. Zwei Männer in verwaschenen Jeans und schwarzen Lederjacken kletterten gerade von einer Stehleiter herab, die unterhalb eines Lüftungsgitters stand. Sie warfen ihm einen kurzen Blick zu, kümmerten sich dann aber um die Leiter und beachteten ihn nicht weiter. Zwei andere, einer davon in Polizeiuniform, untersuchten die Tür der Cessna, seines Flugzeugs. Schon von Weitem erkannte Stein die typische Handbewegung und einen großen Pinsel, mit dem feines Graphitpulver auf einer Fläche aufgetragen wurde, um Fingerabdrücke abzunehmen.
Stein schaute sich weiter in dem Hangar um. Sein Blick blieb an einer kleinen Gruppe von Leuten hängen. Sie standen dicht neben dem Büro, das an der linken Außenwand des Hangars klebte und wie ein gläsernes Geschwür an der riesigen, dunklen Wand wirkte. Er erkannte Otto Wagner, seinen Chef, Christian Welder von der Flughafengesellschaft, dem das Sicherheitsmanagement unterstand, und natürlich Miller. Die beiden anderen Männer, wieder einer in Polizeiuniform, hatte er bisher noch nie gesehen.
„Ah, Stein! Da sind Sie ja. Wir hatten gerade von Ihnen gesprochen“, rief ihm Wagner mit brummiger, tiefer Stimme lautstark entgegen. Er winkte ihn dabei mit einer ausladenden Armbewegung zu sich. „Im Hangar wurde heute Nacht eingebrochen. Wie es scheint, haben sich die Jungs aber nur für die Cessna interessiert. Die Herren hier sind vom LKA und untersuchen den Fall.“
„Guten Morgen“, sagte Stein freundlich zu den Beamten, als er nur noch wenige Schritte entfernt war, und fühlt sich zugleich erleichtert. Sie waren nicht seinetwegen gekommen. Sie waren wegen eines simplen Einbruchs hier und hatten von den Dingen, die zwischen Wagner und ihm liefen, keine Ahnung. Beherzt streckte er den beiden Beamten die Hand entgegen und begrüßte gleichzeitig Welder mit einem vertrauten Lächeln.
„Und? Was wurde gestohlen? In der Maschine ist nichts, was für einen einfachen Dieb von Wert sein könnte.“
„Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Wir fragen uns daher, ob Sie uns vielleicht weiterhelfen können. Was ist so interessant an der Cessna, an Ihrem Flugzeug?“, fragte einer der Beamten herausfordernd. Er ließ Steins Hand dabei nicht los und starrte ihn mit einem gekonnten, durchdringenden Blick an. „Oh, entschuldigen Sie, Frank Bremer, LKA 44, Einbruchsdelikte.“
Die drahtige Figur, der mausgraue Anzug, der von einem schweren Mantel fast verdeckt wurde, und das kantige Gesicht wirkten auf Stein irgendwie bedrohlich. Auch Bremers wässrig blaue Augen irritierten ihn. Und plötzlich fiel es ihm ein: Er hatte solch einen Menschen in einem alten Kriegsfilm, in dem Gefangene mit sehr fragwürdigen Mitteln verhört wurden, gesehen. Auch sein Großvater, der vor vielen Jahren verstorben war, hatte ihm als Kind von solchen Leuten erzählt. Seither mochte er niemanden, der ihn an diese Geschichten erinnerte, und sein Unterbewusstsein schien sich schneller Gehör zu verschaffen als sein Verstand.
Erneut bildeten sich kleine Schweißperlen auf seiner breiten, kantigen Stirn und insgeheim verfluchte er sein zu schwaches Nervenkostüm in solchen Situationen. Er konnte nicht wissen, was die Einbrecher in der Maschine gesucht hatten. Aber allein die Tatsache, dass er wusste, was mit der Cessna war, ließ seinen Pulsschlag emporschnellen.
Krampfhaft versuchte er, an etwas anderes, etwas Schönes zu denken. Er wollte nicht noch nervöser werden, als er bereits war. „Nein. Woher soll ich denn wissen, was ein Einbrecher in der Maschine gesucht hat“, blaffte er trotzig, mit aggressiver Stimme zurück und war selbst erstaunt über seinen Tonfall, den er gegenüber dem Beamten anschlug.
„Wo waren Sie heute Nacht?“, setzte Bremer nach, ohne auf die patzige Antwort einzugehen. Stein wurde schlagartig weiß im Gesicht und die winzigen Schweißperlen auf seiner Stirn verdichteten sich zu einem glänzenden Film.
„Ich, ich war zuhause, in meinem Bett“, stotterte er nervös und sah verzweifelt auf das Flughafengelände hinaus, um den kalten, wässrigen Augen Bremers zu entkommen. Er konnte dem durchdringenden, stechenden Blick nicht standhalten und würde, wenn er jetzt unter Druck geriet, sicherlich etwas Falsches sagen.
Er hatte Angst. Angst, dass er sich durch eine unüberlegte Bemerkung, einen Blick, eine Geste, verdächtig machen würde und sein Plan, endgültig auszusteigen, somit gescheitert wäre.
„Haben Sie Zeugen?“, setzte Bremer nach. Er nutzte die Gelegenheit, in der Stein sichtlich verunsichert war und mit seinen Gedanken zu kämpfen schien. Doch noch bevor dieser auf die Frage antworten konnte, schaltete sich Bremers Kollege ein.
„Frank, wir konnten an der Maschine nichts finden. Das Einzige, was wir haben, ist eine nicht verschlossene Flugzeugtür und ein offen stehendes Lüftungsgitter drüben in der Wand. Es fehlt nichts. Noch nicht einmal ein Schraubenzieher.“
„Und was ist mit Sabotage?“
„Auch Fehlanzeige. Der Mechaniker hat alles überprüft. So wie es scheint, wurden die Einbrecher bei ihrer Arbeit gestört und sind unverrichteter Dinge abgezogen.“
„Und wie sind sie hereingekommen?“, fragte Bremer und warf dabei einen kurzen Blick in Richtung Lüftungsgitter, das in etwa sieben Metern Höhe mitten in der Wand eingebaut war.
Der Beamte zuckte nur kurz mit den Schultern und deutete mit einem zusätzlichen Kopfschütteln an, dass an dem Gitter entweder keine Einbruchspuren zu finden waren oder er davon ausging, dass kein Einbrecher durch das Gitter in dieser Höhe eindringen könnte.
„Na schön, danke erst mal“, rief Bremer missmutig. Er wandte sich wieder an Stein, schaute ihm starr in die Augen, und als dieser nicht reagierte, sagte er: „Ich warte auf eine Antwort.“
Stein schluckte den Kloß, der ihm im Hals steckte, hinunter und schüttelte verneinend den Kopf.
„Wie soll ich das verstehen?“, spöttelte Bremer ironisch und ahmte die Kopfbewegung Steins nach. „Keine Zeugen?“
„Nein. Ich habe keine Zeugen“, blaffte Stein verärgert und voller Zorn zurück. Solch eine Art mochte er nun ganz und gar nicht. Auch ein Beamter der Polizei hatte nicht das Recht, ihn so herablassend zu behandeln. „Ich brauche auch keine. Wenn ich in den Hangar möchte, in mein Flugzeug, nehme ich einfach meinen Schlüssel und komme herein. Für was sollte ich einen Zeugen brauchen?“Trotzig und sichtlich verärgert baute Stein sich vor Bremer auf und blickte ihn aus blitzenden Augen herausfordernd an. Mittlerweile war er sich sicher, dass dieser Berliner LKA-Beamte von seinen Aktivitäten nichts wusste. Und da er mit dem Einbruch, bei dem noch nicht einmal etwas gestohlen worden war, nichts zu tun hatte, kehrte seine Courage zurück. Wenn dieser Frank Bremer von ihm etwas wollte, sollte er ihn vorladen. Wenn nicht, sollte er einfach verschwinden.
„Ja, da haben Sie recht“, antwortete Bremer daraufhin und reagierte in keiner Weise so, wie Stein es erwartet hatte. „Ich denke, wir schreiben unseren Bericht und damit ist die Sache für uns erledigt; vielen Dank für Ihre Mitarbeit und auf Wiedersehen“, spulte Bremer herunter und ging, ohne sich noch einmal zu den anwesenden Personen umzudrehen, aus dem Hangar hinaus.
Kurz darauf verließen auch Bremers Kollegen und die Männer der Spurensicherung – mit jeweils einem freundlichen Kopfnicken – den Hangar. Auch Welder schloss sich den Männern der Polizei kommentarlos an, da es offensichtlich für ihn nichts mehr zu tun gab.